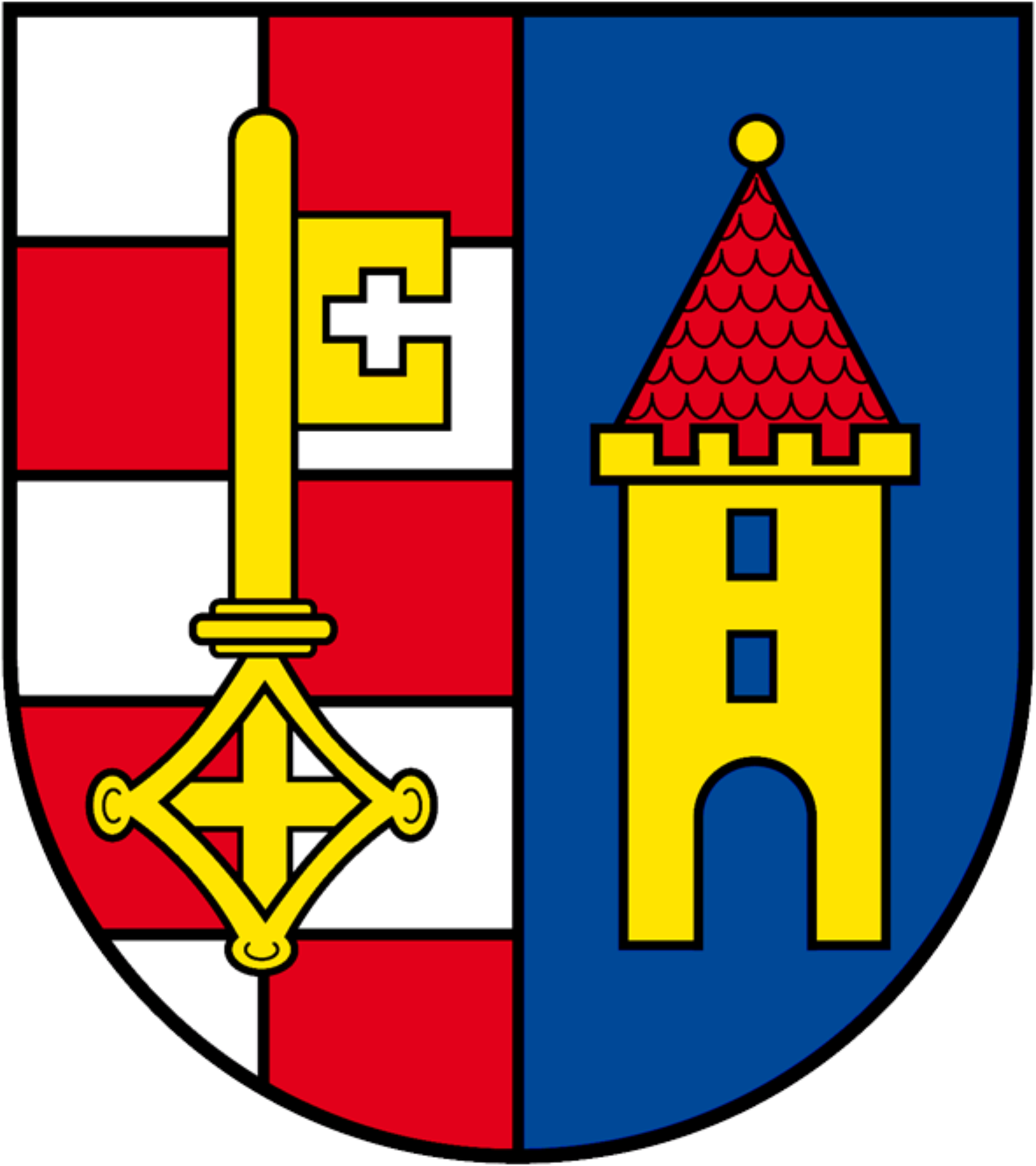Es war einmal ein Wahnschmerkrämer, der mit seinem klapprigen Wagen drei Tage lang durch das beschauliche Städtchen Dill fuhr – Er war auf der Suche nach potenziellen Kunden denen er seine Wahnschmer andrehen konnte und nach der Ausfahrt aus dem Städchen. Niemand wusste, woher er kam, und niemand wollte ihm den Weg weisen, denn Dill war ein geheimnisvoller Ort. Die Straßen führten im Kreis, die Schilder zeigten ins Nichts, und die Einheimischen sprachen in Rätseln.
Der Krämer wurde bald zum Gespenst der Gassen – man hörte sein Rufen: „Wo geht’s hier raus?“ – und das Quietschen seiner Räder bei Nacht. Manche sagen, er fährt noch heute, wenn der Nebel tief hängt und die Kirchturmuhr rückwärts schlägt.
(Wagenschmiere: Ist eine Mischung aus Teer, Fett oder Öl zum schmieren der Wagenachsen bei Holzwagenrädern von Leiterwagen .)
In den nebligen Nächten, wenn der Mühlbach wild toste und die Bannmühle bebte, erzählte man sich in Dill von zwei Wesen, die unter der alten Zugbrücke hausten: das Portekalb – halb Kalb, halb Schatten – und der Hokelmann, ein buckliger Wassergeist mit glühenden Augen.
Sie warteten auf den Klang der Mitternachtsglocke, denn dann stieg der Hokelmann aus dem Bach und das Portekalb stampfte durch die Gassen, auf der Suche nach verlorenen Seelen. Wer sich zu dieser Stunde der Brücke näherte, hörte ein Grollen, als würde der Mühlbach selbst sprechen.
Man sagt, einst sei ein Müllerjunge zur Bannmühle geflohen, verfolgt von den beiden Kreaturen. Doch als er die Brücke überquerte, verschwand er spurlos – und seither fließt der Mühlbach nie ohne Getöse.
Der Hokelmann ist ein Wassergeist als Schreckgestalt für
Kinder, Der Hokelmann sitzt angeblich in Brunnen, Bächen oder unten im Plumpsklo und zieht Kinder mit einem Haken zu sich herab.
Die Geschichte vom Mühlbach in Dill ist ein wunderbares Beispiel für die Magie, die in der Landschaft und Geschichte des Hunsrücks verborgen liegt. Die Vorstellung, dass der Mühlbach scheinbar den Berg hinauf fließt, ist eine optische Täuschung, die seit jeher die Fantasie der Menschen beflügelt hat.
Ganze Schulklassen haben sich dieses Phänomen in den 60er Jahren nicht entgehen lassen, sie sind angereist und haben sich diese optische Täuschung angesehen, neben der leicht ansteigenden Straße die durch den Halsgraben verlief floss der Mühlbach in die gleiche Richtung unter der Zugbrücke durch Richtung Bannmühle, die Straße hatte eine leichte Steigung, für den Betrachter sah es so aus das der Mühlbach auch den Berg hinauf lief.
Der Dichter Adolf Martin hat dieses Naturphänomen poetisch eingefangen mit den Worten:
„Wanderer hemme deinen Lauf, hier fließt das Wasser den Berg hinauf.“
Diese Zeile ist nicht nur ein literarisches Schmuckstück, sondern auch ein Hinweis darauf, wie stark die Natur mit der regionalen Identität verwoben ist. Die Täuschung entsteht vermutlich durch die Perspektive des Geländes und die Art, wie der Bach verläuft – ein Spiel zwischen Höhenlinien und Blickwinkel.
Die Region um Dill ist reich an Geschichte: Die Burg Dill, einst Stammsitz der Grafen von Sponheim, thront über dem Dorf und war einst durch eine Zugbrücke über den Mühlbach erreichbar. Die Verbindung von Natur und Bauwerk verstärkt die mystische Wirkung des Ortes.
In den nebelverhangenen Hügeln des Hunsrück, rund um die Ruine der ehrwürdigen Burg Dill, erzählt man sich seit Jahrhunderten von seltsamen Wesen: den Dilldappen. Diese Fabeltiere – eine Mischung aus Hamster, Iltis, Kaninchen und Reh – sollen einst in den Scheunen und Wäldern rund um Dill ihr Unwesen getrieben haben.
Ursprung der Dilldappen
Man glaubt, dass fahrende Händler im Mittelalter die Dilldappen aus dem Siegerland nach Dill brachten. Die Tiere waren klein, flink und hatten eine rauhe Raspelzunge, mit der sie Kräuter und Gemüse zermahlten. Besonders liebten sie das Kraut, das später als Dill bekannt wurde – daher ihr Name.
Die Burg und das Suppenkraut
Eine lokale Legende erzählt von einem Koch namens Erhardt, der auf Burg Dill eine besondere Suppe zubereiten wollte. Als die Magd Agata versehentlich Kräuter von einem Strauch an dem zuvor Dilldappe gefressen hatten einsammelte, entstand eine köstliche Minestrone, die den Burgherrn begeisterte. So wurde das Kraut „Dill“ getauft – und die Tiere, die es fraßen, hießen fortan Dilldappen.
Die Sage lebt weiter
Noch bis vor wenigen Jahrzehnten sollen Dilldappen in den Heustöcken der Bauern geschlafen haben. Wer nachts in die Scheunen ging, hörte Rascheln, Fiepen und sah Schatten huschen. Doch die Tiere waren harmlos – nur gefürchtet wegen ihrer Vorliebe für Vorräte und ihrer nächtlichen Aktivität.
Heute sind die meisten Scheunen leer, die Dilldappen verschwunden, doch ihre Geschichte lebt in Erzählungen, Wanderwegen und sogar Fanclubs weiter. Und wer sich bei Vollmond in die Nähe von Burg Dill wagt, hört vielleicht noch das leise „Dappen“ kleiner Pfoten im Gras…
Es war einmal im Jahr 920, als das kleine Dorf Dill, verborgen zwischen den sanften Hügeln des Hunsrücks, inmitten von Chaos und Gefahr aufblühte. Die Luft war erfüllt von der Angst vor Überfällen und Plünderungen, die durch die unbarmherzigen Ungarneinfälle und umherziehende Banden verursacht wurden. In dieser gefährlichen Zeit zogen sich die Vorfahren der heutigen Bewohner in eine natürliche Festung zurück, um sich vor den Schrecken der Welt zu schützen.
Umgeben von einem klaren, plätschernden Bach, errichteten sie auf einem Bergsporn steile Mauern und gruben tiefe Gräben. Mit jedem Stein, den sie schichteten, und jedem Graben, den sie aushoben, wuchs die Hoffnung auf Sicherheit. Die Festung, die sie erbauten, wurde zum Grundstein für eine blühende Gemeinde. Über die Jahrhunderte hinweg verwandelte sich die Festung in eine prächtige Burg, von einer Burg in ein nobles Schloss, und das umliegende Dorf blühte auf, wurde zu einer Stadt mit freien Bürgern und lebhaften Märkten.
Doch das Schicksal war nicht immer freundlich. Im Jahr 1697, während des Pfälzischen Erbfolgekriegs, fiel die Burg in die Hände der Franzosen. Sie belagerten, plünderten und zerstörten, was einst ein Symbol der Stärke und des Schutzes war. Die Bewohner von Dill Kirchberg, Kastellaun und Simmern standen vor den Trümmern ihrer Träume, doch die Entschlossenheit der Diller war ungebrochen.
Heute, über 1000 Jahre nach der Gründung, erstrahlt Dill in neuem Glanz. Die liebevoll restaurierten Fachwerkhäuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert erzählen Geschichten von Mut und Beständigkeit. Die Oberburg, umgeben von einer schützenden Ringmauer, ist ein beliebtes Ziel für Besucher. Hier kann man die Überreste der Wachtürme und die Grundmauern des Bergfrieds bewundern, während der Wohnturm mit seinem geheimnisvollen Gewölbekeller Geschichten aus längst vergangenen Zeiten flüstert.
In der Niederburg zieht die barocke Burgkapelle mit ihren kostbaren Gemälden des Kirner Künstlers Johann Georg Engisch die Blicke auf sich. Hier, wo der Brunnen sprudelt und das Pfarrhaus steht, spürt man den Puls der Geschichte. Dill ist nicht nur ein Dorf; es ist ein lebendiges Märchen, das die Herzen der Menschen berührt und sie in die faszinierende Vergangenheit entführt.
So lebt die Legende von Dill weiter, ein Zeugnis für die Stärke und den unerschütterlichen Geist seiner Bewohner, die auch in den dunkelsten Zeiten nie den Glauben an eine bessere Zukunft verloren haben.